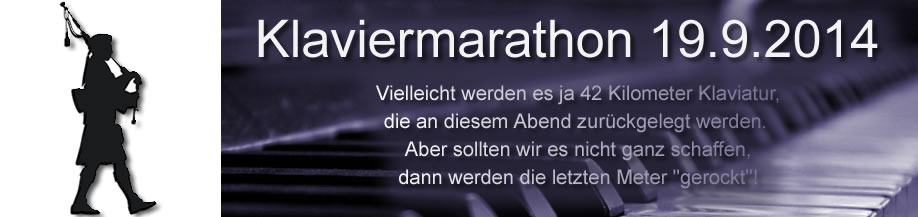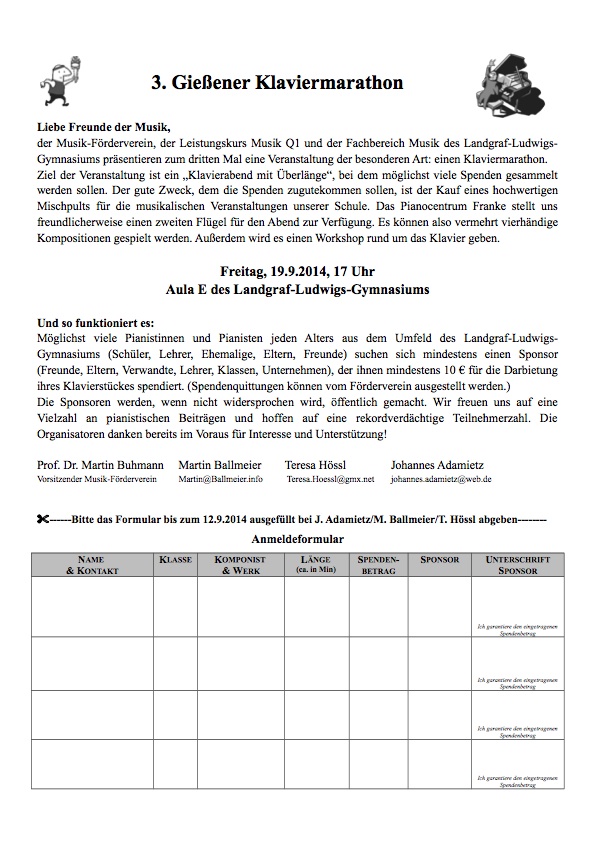Larissa Marie Schwarz (Jahrgangsstufe 12) hat im Rahmen des Projektes „Jugend und Wirtschaft“, das von der F.A.Z. (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und dem Bundesverband deutscher Banken zum vierzehnten Mal durchgeführt wurde, einen von drei Artikelpreisen gewonnen. In dem Projekt geht es darum, Wirtschaftsthemen zu recherchieren und Zahlen, Daten, Fakten und selbst durchgeführte Interviews so interessant und fundiert aufzubereiten, dass im Idealfall ein Artikel entsteht, der den hohen Ansprüchen der F.A.Z genügt und auf der einmal im Monat erscheinenden Jugend und Wirtschaft- Seite im Wirtschaftsteil der FAZ abgedruckt wird. An dem Projekt haben im Projektjahr 2013/2014 60 Schulen mit insgesamt über 1.200 Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Bundesgebiet teilgenommen.
Larissa Marie Schwarz (Jahrgangsstufe 12) hat im Rahmen des Projektes „Jugend und Wirtschaft“, das von der F.A.Z. (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und dem Bundesverband deutscher Banken zum vierzehnten Mal durchgeführt wurde, einen von drei Artikelpreisen gewonnen. In dem Projekt geht es darum, Wirtschaftsthemen zu recherchieren und Zahlen, Daten, Fakten und selbst durchgeführte Interviews so interessant und fundiert aufzubereiten, dass im Idealfall ein Artikel entsteht, der den hohen Ansprüchen der F.A.Z genügt und auf der einmal im Monat erscheinenden Jugend und Wirtschaft- Seite im Wirtschaftsteil der FAZ abgedruckt wird. An dem Projekt haben im Projektjahr 2013/2014 60 Schulen mit insgesamt über 1.200 Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Bundesgebiet teilgenommen.

Am 16.9. unternahmen 15 Schülerinnen und Schüler des LK Physik der Q3 zusammen mit einigen Interessierten aus den Physik-Grundkursen eine Exkursion zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Göttingen (DLR). Die Fahrt war ein Geschenk der JLU Gießen für das gute Abschneiden des LLG (2.Platz) bei der diesjährigen Vorlesungsreihe „Physik im Blick“. Göttingen gilt als eine Wiege der Aerodynamik. Bereits 1907 wurde hier die weltweit erste staatliche Forschungseinrichtung für die Luftfahrt eingerichtet. Heute arbeiten hier 430 Fachleute in unterschiedlichen Forschungsbereichen.
 Nachdem Herrn Kranitz im Saal des DLR_School_Lab eine Übersicht über die verschiedenen Forschungsschwerpunkte des DLR (Raumfahrt, Aerodynamik, Energie) gegeben hatte, ging es zur ersten Station: Der Beschleuniger, mit dem physikalischen Bedingungen simulieren lassen, die auf der Oberfläche eines Raumgleiters beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auftreten, beeindruckte sowohl durch seine Ausmaße (30m Länge) als auch durch die bei den Versuchen entstehenden Kräfte (bis 5 Meganewton).
Nachdem Herrn Kranitz im Saal des DLR_School_Lab eine Übersicht über die verschiedenen Forschungsschwerpunkte des DLR (Raumfahrt, Aerodynamik, Energie) gegeben hatte, ging es zur ersten Station: Der Beschleuniger, mit dem physikalischen Bedingungen simulieren lassen, die auf der Oberfläche eines Raumgleiters beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auftreten, beeindruckte sowohl durch seine Ausmaße (30m Länge) als auch durch die bei den Versuchen entstehenden Kräfte (bis 5 Meganewton).
 Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler beim Bau eines Gleiters aus Styroporplatten selbst kreativ werden und die Flugeigenschaften unterschiedlicher Bauarten ausprobieren.
Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler beim Bau eines Gleiters aus Styroporplatten selbst kreativ werden und die Flugeigenschaften unterschiedlicher Bauarten ausprobieren.
Nach einer Mittagspause in der Kantine des DLR standen Experimente in Kleingruppen auf dem Programm. Unter fachkundiger Anleitung konnten der (inzwischen stillgelegte) imposante, über mehrere Etagen reichende Windkanal des DLR besichtigt und das Strömungsverhalten von Auto-, Eisenbahn- und Flugzeugmodellen in einem Miniaturwindkanal getestet werden. In einer anderen Gruppe wurde der ideale Anstellwinkel eines Hubschrauberpropellers mit computergesteuerter Messtechnik untersucht. Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit dem Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit.
Ein Fliegerwettbewerb mit den selbstgebauten Gleitern und die Übergabe von Teilnahmeurkunden rundete den informativen und kurzweiligen Aufenthalt am DLR ab.
Anerkennungspreise für acht LLG-Schüler im Bundeswettbewerb Fremdsprachen: Anspruchsvolle Aufgaben und sechsstündige Klausur
GIESSEN - (red). Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen gilt als einer der renommiertesten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Seit mehreren Jahrzehnten fördert und fordert er Jugendliche, die Spaß an fremden Sprachen und Kulturen haben. Auch einzelne Schüler oder Gruppen des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG) sind immer mit dabei – und zwar mit der Sprache Latein. Im Durchgang 2013/14 gingen nun Julia Haas (8e), Joshua Olbrich, Max Brandl, Lars Reichl, Paula Roth, Margarethe Stein, Niklas Breidenbach und Emanuel Herrendorf (alle 9e) ins Rennen.
Alle durften sich nun über Urkunden freuen, in denen ihnen Latein-Kenntnisse bescheinigt werden, „die über das in der Schule geforderte Niveau hinausgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des LLG. Als zusätzliche Anerkennung werden sie am letzten Schultag während einer Schülerehrung von der Werner-Schiffner-Stiftung, die von einem ehemalige Kollegen am LLG gegründet worden ist, Preise und Urkunden bekommen.
Lateinlehrer Dr. Marc Steinmann, der die LLG-Lateiner im Wettbewerb betreut hatte, freute sich, „dass die Schüler auch im achtjährigen Gymnasium noch Zeit und Lust haben, mehr in ein Schulfach zu investieren als von ihnen im normalen Unterricht verlangt wird“. Auch die Gymnasiasten selbst waren zufrieden und äußerten sich sehr positiv über die zusätzliche Möglichkeit, vorhandene Kenntnisse zu erweitern und einer „vermeintlich toten Sprache noch mehr Leben einzuhauchen“. Ein Schüler formulierte seine Motivation teilzunehmen so: „Latein ist einfach eine coole Sache.“
Die Wettbewerber müssen zu Hause Aufgaben bearbeiten und abschließend eine sechsstündige Klausur schreiben. Bewertet werden ein auf einem Tonträger aufzunehmender lateinischer Vorlesetext, eine lateinisch-deutsche Übersetzung ohne Hilfe eines Wörterbuches, grammatische, stilistische und kulturelle Kenntnisse, Sprachentransfers zwischen Latein und den romanischen Sprachen sowie das Hörverstehen, also Latein als Kommunikationssprache. Das übergeordnete Thema lautete diesmal „Reisen in der Antike“. Dabei mussten zum Beispiel die Helden verschiedener (fiktiver) Reiseromane korrekt zugeordnet, Inschriften gedeutet und ergänzt, antike Reisesouvenirs an ihre Ursprungsorte versetzt, Aufgaben zu den berühmten Reisen des Odysseus und des Aeneas bearbeitet sowie einzelne Abschnitte einer spanischen Beschreibung des römischen Straßenbaus passenden Illustrationen zugeordnet werden.
Träger des Wettbewerbs ist „Bildung und Begabung“, das Zentrum für Begabtenförderung in Deutschland. Unterstützt wird die Veranstaltung auch durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Der traditionelle Englandaustausch mit der Little Heath School in Reading konnte dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden. Dennoch ist es gelungen, dass 26 Schüler aus der 7., 8. und 9. Klasse nach England fahren konnten. Sie wohnten in ausgewählten englischen Gastfamilien für eine Woche im Mai in dem Seebad Eastbourne (Südengland) in der Grafschaft East Sussex. Sie konnten vor Ort eine andere Kultur (u.a. andere Wohn-und Essgewohnheiten) kennenlernen, interkulturelle Erfahrungen sammeln und ihre Sprachkompetenzen mit einem ‚native speaker’ erweitern. Sie lernten Dinge kennen, die man sonst nur aus Schulbüchern, Postkarten oder dem Fernsehen kennt. Eastbourne gehört zu den Orten Englands mit den meisten Sonnenstunden im Jahr und liegt an der sogenannten ,Sunshine Coast’.

...trotzdem regnete es manchmal.
Schüler des LLG erhielten praktische Tipps zur eigenen Lebensplanung sowie Bedeutung der Körpersprache
Körpersprache, Rhetorik und persönlicher Auftritt sind für jeden wichtig. Bis zu 70 Prozent entscheiden diese Soft-Skills über den Erfolg von Kommunikation, privat wie beruflich. Es kommt also immer auch darauf an, wie etwas gesagt wird, weniger entscheidend ist dabei was gesagt wird. Wichtig ist, dass man von dem was man tut überzeugt ist. „Authentizität entscheidet“, so Holger Fischer, ehemaliger Schüler am Landgraf-Ludwig-Gymnasium und Inhaber der Confidos Akademie Hessen aus Gießen. {gallery}2013/Koerper{/gallery}
„Diese Erkenntnisse werden in der Schule oft nur rudimentär vermittelt“, ist Thorsten Rohde, Lehrer am LGG Gießen, überzeugt. Holger Fischer war zusammen mit Peter Gerst, der als freiberuflicher Köpersprachetrainer und Schauspieler ebenfalls für die Confidos Akademie Hessen tätig ist, gerne der Einladung Rohdes gefolgt. Ziel war es, den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten des Grundkurses Wirtschaft und Politik in zwei Unterrichtsstunden viele Tipps rund um das Thema persönliche Lebensplanung und die besondere Wirkung der Körpersprache zu geben. Fischer berichtet zunächst über seinen persönlichen und nicht immer gradlinigen Weg von der Schule über diverse berufliche Stationen bis hin zur Gründung seiner Akademie. Trainer Peter Gerst skizzierte ebenfalls seinen abwechslungsreichen beruflichen Werdegang. Dabei verwiesen beide auf die Bedeutung des persönlichen Auftritts, den jeder immer verbessern könne. Fischer und Gerst empfahlen den Schülerinnen und Schülern bei ihrer Berufs- und Studienentscheidung auch für das zu entscheiden, wovon sie überzeugt seien und nicht ausschließlich zeitlich oftmals begrenzten Trends hinterherzulaufen. Wichtig sei bei der persönlichen Lebensplanung die Authentizität unter Einbeziehung der persönlichen Rahmenbedingungen um glücklich und erfolgreich zu sein, waren sich die beiden Gäste einig. Die Bedeutung der Körpersprache und deren Wirkung wurden anschließend von Peter Gerst in einigen sehr anschaulichen und zum Teil humorvollen Spielszenen den Schülerinnen und Schülern aufgezeigt. Auch hatten diese ausreichend Zeit, während der beiden Unterrichtsstunden ihre persönlichen Fragen mit dem ehemaligen LLG-Schüler sowie Kommunikationstrainer Gerst zu diskutieren.

Demnächst am LLG
| 27 Jan. 2026, Mensa geschlossen |
| 27 Jan. 2026 , 11:30 - 12:30, Aufführung Darstellendes Spiel Q3 - Krabat/Ottfried Preußler (Sö) |
| 27 Jan. 2026 , 18:00 - 19:00, Aufführung Darstellendes Spiel Q3 - Krabat/Ottfried Preußler (Sö) |
| 28 Jan. 2026, Hochschulinformationstage 2026 für die Q1/Q3 |
| 29 Jan. 2026 , 18:00 - 20:30, MINT-Abend (MM, Sk) |
| 30 Jan. 2026, Probenwochenende Musical |
| 30 Jan. 2026, Zeugnisausgabe und Verabschiedungen |